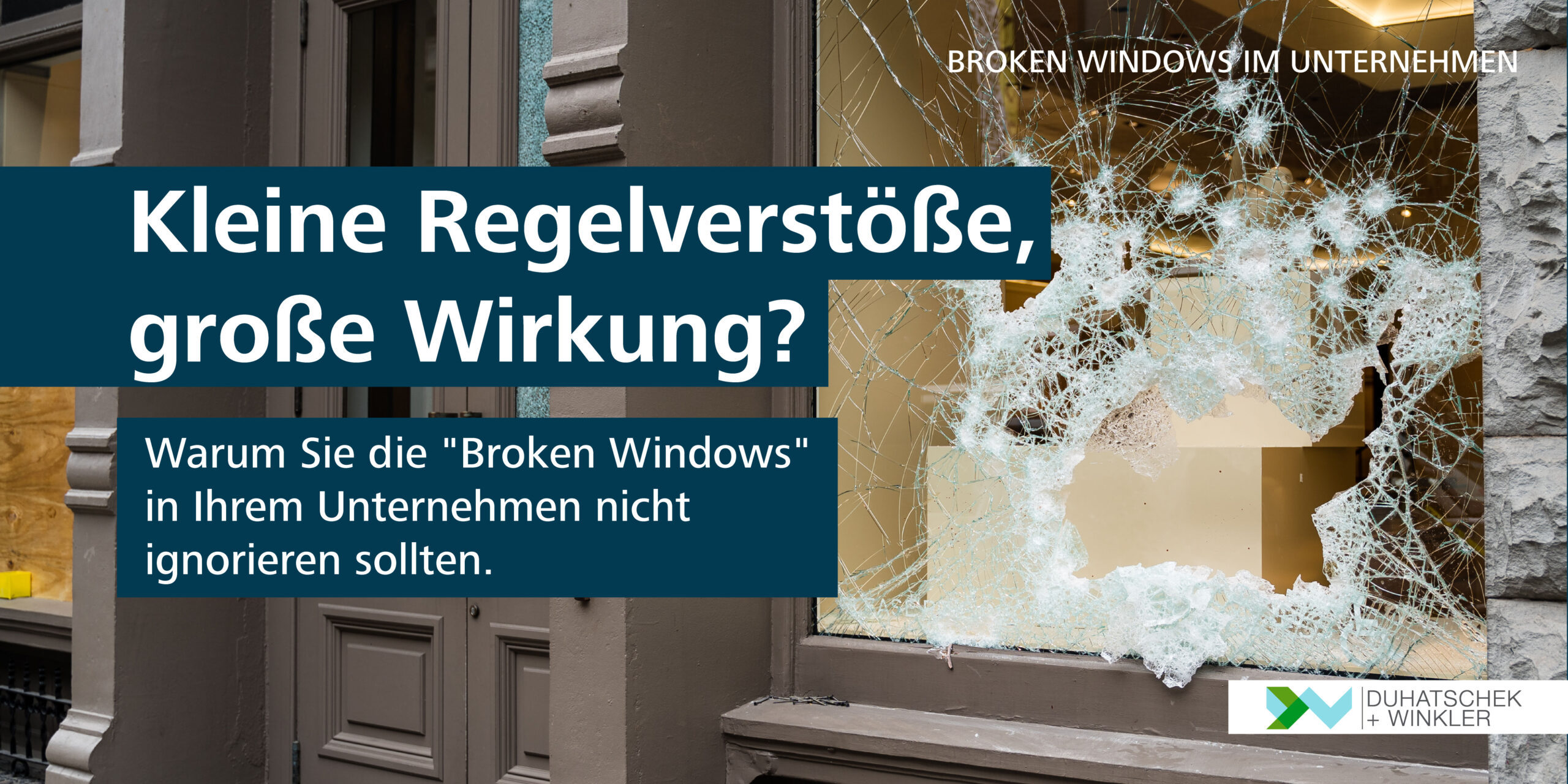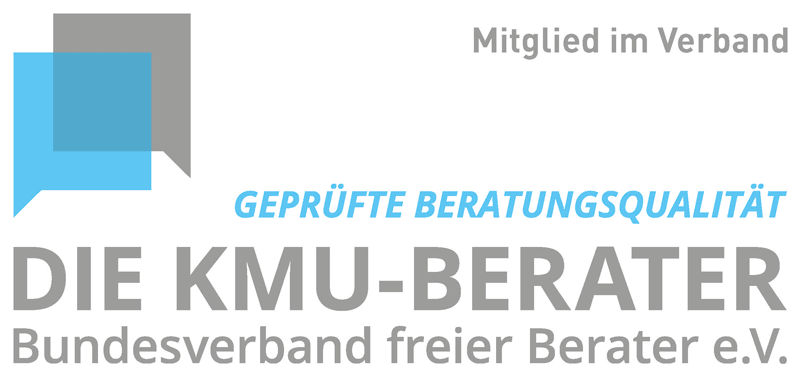Deutsche Industrie-Unternehmen setzen bei der Bewältigung der Corona-Krise auf Rationalisierung und Digitalisierung. Setzen sie dabei auf die richtigen Pferde?
In einer breit angelegten Umfrage des DIHK wurde deutlich: Die Industrie setzt zur Krisenbewältigung auf die Instrumente der Rationalisierung und auf die Digitalisierung. Bei der Umfrage wurde deutlich, dass die Lage vieler Unternehmen trotz der Lockerungen sehr kritisch bleibt. Dies bedeutet, dass eine Rückkehr zur Normalität nicht in Sicht ist.
Umsatzrückgänge machen Maßnahmen erforderlich
Auch wenn nicht jede Branche gleich betroffen ist, rechnet die Mehrzahl der Unternehmen mit deutlichen Umsatzrückgängen. Während die Automobilindustrie sehr stark betroffen ist, sind die Pharmaindustrie, die Kosmetikindustrie, der Handel mit Lebensmitteln oder das Baugewerbe viel weniger beeinträchtigt. Die Nachfrage ist in manchen Wirtschaftsbereichen so rückläufig, dass die Betriebe Rückgänge von bis zu 50% erwarten, in einzelnen Bereichen sogar noch mehr.
Die Bundesregierung hat die Möglichkeit geschaffen, auf die bestehende schwache Nachfrage mit Kurzarbeit zu reagieren. Die abgesenkte Umsatzsteuer ist eine Möglichkeit, um kleinere Preisimpulse an die Verbraucher zu geben und zu Käufen zu ermuntern. Aus dem Rückgang folgen Liquiditätsprobleme. Soforthilfe, Sofortdarlehen und Überbrückungshilfen sind das Angebot der Bundesregierung. Die bedingte Aussetzung der Insolvenzantragspflicht soll ein Eskalieren der Lage begrenzen. Die Folge der nationalen und die europabezogenen Maßnahmen ist eine drastische Verschuldung des Staates. Dies macht deutlich, dass solche Hilfsmaßnahmen nicht unbegrenzt wiederholbar sind. Letztlich müssen die Unternehmen selbstwirksam die Krise bewältigen.
Bewältigung der Krise durch Rationalisierung
43 Prozent der Industrieunternehmen setzen auf Rationalisierung, damit sie die Krise bewältigen können. Dies ist die grundsätzlich richtige Antwort auf rückläufige Marktentwicklungen. Was genau kann mit dieser plakativen Aussage gemeint sein? Wenn es darum geht, Mitarbeiter durch Maschinen zu ersetzen bis hin zur Automatisierung und dem Einsatz von Industrierobotern, fehlt die ausreichend hohe Nachfragemenge. Geht es um den Ersatz von technisch überholten Betriebsmitteln durch wirtschaftlich effizientere, so wären Rationalisierungsinvestitionen die Folge. Gerade diese Investitionen bleiben bis heute aus. Meinen die Unternehmen die Verbesserung der Aufbau- oder Ablauforganisation, wenn Arbeitsprozesse zu einem höheren Wirkungsgrad optimiert werden? Sicher ist dies ein Fokus, wenn dadurch Kurzarbeit intensiv genutzt werden kann.
Rationalisierung muss ohnehin ein permanenter Prozess im Unternehmen sein. Wenn dies der einzige Blickwinkel ist, sind die Folgen für die Unternehmensentwicklung negativ. Die notwendigen Innovationen, beispielsweise im Geschäftsmodell und in den Produkten, bleiben aus.
Bewältigung der Krise durch Digitalisierung und durch Änderung des Geschäftsmodells
Auf die Bewältigung der Krise durch Digitalisierung setzen 39 Prozent der Industrieunternehmen. Wenn die Digitalisierung auf die Verbesserung der Prozesse und Abläufe zielt, ist dies eine Spielart der Rationalisierung. Nur etwas über 20 Prozent der Industrieunternehmen legen tatsächlich den Fokus darauf, das Geschäftsmodell umzustellen. Gerade darin, das Geschäftsmodell auf die aktuelle Gegebenheit anzupassen, liegt das größte Potenzial. Wenn Geschäftsmodelle ihr Verfallsdatum überschritten haben, nutzt es wenig, daran festzuhalten und den Mitteleinsatz wirtschaftlich zu optimieren. In Krisen verändern die Verbraucher ihr Verhalten. Dies zeigt sich in neuen und veränderten Märkten. Diese Märkte fordern innovative Geschäftsmodelle.
Coaching unterstützt Führungskräfte in der Entwicklung des Geschäftsmodells
Bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle handeln die Führungskräfte in der aktuellen Situation unter hohem Zeitdruck. Unter Stress und in Krisensituationen funktionieren Denk- und Entscheidungsprozesse anders. Die differenzierte Wahrnehmung wird beeinflusst. Als Folge kommen unbewusste Entscheidungsfindungen zum Tragen. Lösungen werden überwiegend durch einen Ähnlichkeitsvergleich gesucht. Es geht darum, Handlungen anderer zu erkennen, die in einer vergleichbaren Situation erfolgreich waren. Sofern dieser Ähnlichkeitsvergleich zu keiner passenden Lösung geführt hat, entscheiden sich Führungskräfte unter Druck oft für die verbreitetste unter den bekannten Handlungen und Maßnahmen.
In der Führung sind defensive Entscheidungen verbreitet. Die Führungskräfte wählen oft nicht die sachlich beste Option. Stattdessen bevorzugen sie die Option, die das geringste Risiko für die Unternehmung oder für die eigene Position birgt. Diese Alternative kann bequemer sein, weniger Gegenwind verursachen oder die Möglichkeit bieten, die Verantwortung für Fehlentwicklungen weiterzugeben oder zu vermeiden. Dies ist die Erkenntnisse aus einer breit angelegten Studie des Max-Planck-Institutes in 2019.
Wenn die Möglichkeiten stark begrenzt sind, sollten die Entscheidungen zielgerichtet und optimal für die individuellen Gegebenheiten eines Unternehmens erarbeitet werden. Systematisches Coaching hilft dabei, nicht in diese Handlungsfallen zu geraten, sondern mit angemessenem Druck die eigenen Ziele herauszuarbeiten, die Führungskultur zu verändern, offensiv mit Fehlern und Lernen umzugehen, damit man wirklich neue Geschäftsmodelle erarbeiten kann.
Coaching und Beratung unterstützt die Unternehmen bei der Bewältigung der Corona-Krise
Sie suchen einen externen Gesprächspartner? Sind zudem Erfahrungen in Ihrer Branche sind wichtig? Sie wünschen Unterstützung im Controlling und im Bereich Digitalisierung? Die Finanzierungsvorhaben möchten Sie außerdem noch schneller realisieren? Dann sprechen Sie mit uns einfach über Ihre Anforderungen.